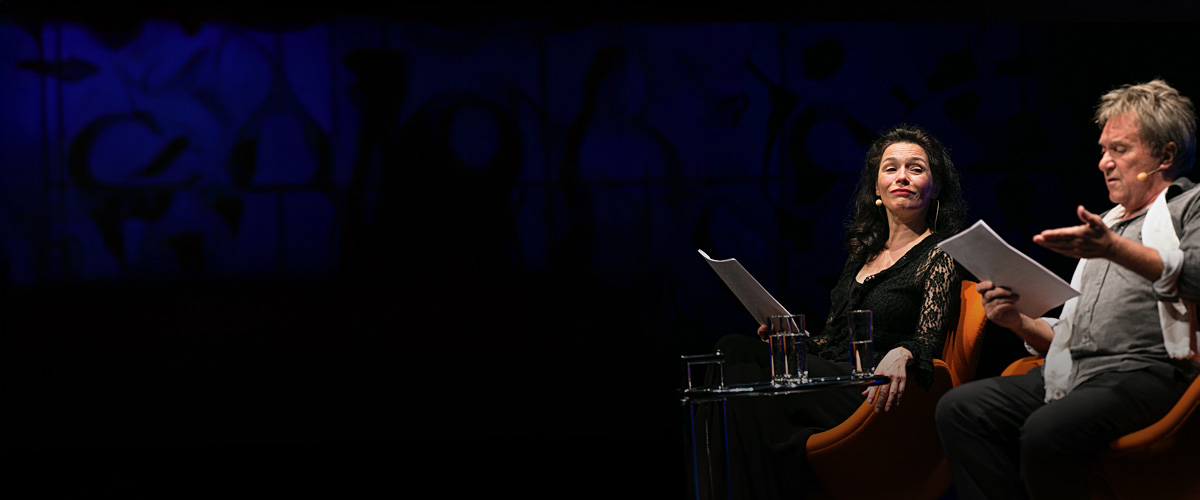Der etablierte Kulturbetrieb ist wenig subversiv. Das sehen wir an Friedrich Gulda, der sich ganz besonders von Einengungen des bürgerlichen Kulturlebens provoziert fühlte. Dimitri Schostakowitsch musste unter den repressiven Bedingungen in der Sowjetunion ganz andere Einschränkungen hinnehmen. Gemeinsam ist Beiden, dass sie gerade diese Umstände erst richtig produktiv machten. Solche Gedanken weckt eine neue bemerkenswerte Produktion mit dem Cellisten Friedrich Kleinhapl und dem Wiener Concert-Verein unter Leitung von Rudolf Piehlmayer.
Vor allem Guldas Konzert für Cello und Blasorchester dürfte für die meisten Musikfreunde eine Neuentdeckung sein: In fünf collagenhaften Sätzen erleben wir den Komponisten Gulda, wie dieser auf die Barrieren zwischen „U und E-Musik“ fröhlich eindrischt.Wie ein markiger Weckruf bringt Kleinhapls Cello mit seinem Eröffnungsmotiv das Orchester auf Touren. Es ist mit Schlagwerk verstärkt, um treibend drauflos zu swingen – auf dass die Notenblätter des Klassikbetriebs fröhlich durcheinander gewirbelt werden und die zeitgenössiche Journaille bei der Uraufführung Anfang der 1980er Jahre derart brüskiert war, dass von einem „musikalischen Furz“ die Rede war. Aber Gulda beherrscht die musikalischen Mittel viel zu elegant, als dass diese Formulierung heute noch gültig wäre. Er lässt den Jazz-Part in fliegendem Wechsel in ein Mozartsches Motiv münden, woraufhin die Jazzmaschine wieder Vollgas gibt, so das auch der in Würde ergraute Adorno erbleichen würde. Wunderbar, wie Gulda allen und jedem musikalisch hier die Nase drehen will. Hörner tröten zum alpenländischen Idyll zu Beginn des zweiten Satzes. Ist es Persiflage oder Liebeserklärung an die österreichische Heimat? Hier darf sich jeder frei fühlen, es selber für sich zu definieren. Ein virtuoser Parforceritt in einer Cellokadenz schließt sich an und fordert den Cellisten Kleinhapl heraus, zu zeigen, dass es Gulda bei aller Spaßhaftigkeit stets ums musikalisch Eingemachte geht. In einem schwelgerisch lyrischen Menuett gesellt sich eine Gitarre zum Violoncello, bevor sich alle miteinander in lärmenden Festzelt-Trubel stürzen – aber auch das ist wieder hohe Kunst, wenn sich Kleinhapls Cellospiel über allen musikalischen Tumult souverän und virtuos erhebt!
Wo es Gulda um sarkastische Befreiungsschläge von Genre-Konventionen ging, da begab sich Schostakowitsch vor allem des Broterwerbs wegen in die Unterhaltungsbranche – vor allem, wenn er für das neue Medium des Films komponierte. Dass dies mit Leidenschaft, Herzblut, hohem Gespür für Atmosphäre und Klangsinnlichkeit geschah, demonstrieren Kleinhapl und das Orchester aus Wien in der folgenden Suite für Violoncello und Blasorchester in einem Arrangement von Alexander Wagendristel. Walzer, Polka, sentimentale Romanzen, Foxtrott heißen diese Kabinettstückchen, die zwar definitiv kein Jazz sind, auch wenn sie expliziert „für Jazzorchester“ gesetzt sind, aber für imaginäre Traumsequenzen allemal gut sind und einen mal nicht allzu tiefschürfenden, sondern dafür sehr diesseitsgewandten Schostakowitsch offenbaren.
Diese Aussagekraft ist in erster Linie dem großartig präsenten, kraftvollen Cellospiel von Kleinhapl zu verdanken. Er bearbeitet die Saiten mit zupackendem Biss, schaltet blitzschnell zwischen Aggregatzuständen und Stimmungen um, lässt Farben leuchten und Emotionen lodern. Und kann in jedem Moment auf das hellwache, von Rudolf Piehlmayer dirigierte Orchester vertrauen.